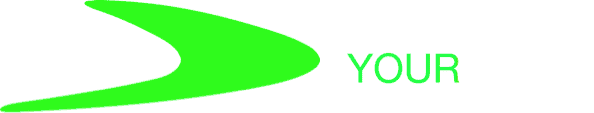Im Alltag erkennen wir alle bestimmte Situationen wieder, zum Beispiel Geräusche oder Objekte. Wir lernen aus Dingen, die uns begegnet sind und die uns dann sehr vertraut werden, und können sie sofort wiedererkennen. Dadurch beginnt unser Gedächtnis zu wachsen und wir entwickeln sozusagen ein Mustererkennungssystem. Diese Fähigkeit, Informationen zu sammeln und zu nutzen, kann uns auch bei Entscheidungen im Zusammenhang mit bestimmten Lawinenproblemen und Geländebedingungen im Gebirge zugutekommen. Skifahrer lernen die fünf Lawinenprobleme kennen und entwickeln ein Verständnis bzw. eine Mustererkennung, je häufiger sie mit diesen Situationen im Gebirge konfrontiert werden.
Im Folgenden finden Sie die fünf Lawinenprobleme und einige allgemeine Informationen zur Beschreibung der Lawinenprobleme.
Die folgenden Faktoren sind allen Lawinen gemeinsam:
Gelände, Neigung von 30 Grad oder mehr, Lawinenstufe/täglicher Lawinenbericht, Hangrichtung, Temperatur und Tageszeit.

NEW SNOW

WIND DRIFT SNOW

PERSISTANT WEAK LAYERS (OLD SNOWPACK)

WET SNOW
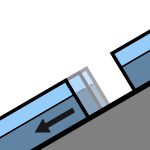
GLIDING SNOW
NEUSCHNEE

Welche Neuschneemengen sind für Freeride, Tourengehen und Backcountry kritisch?
Bei ungünstigen Verhältnissen: 10 bis 30 cm
Bei mittleren Verhältnissen: 20 bis 30 cm
Bei günstigen Verhältnissen: 30 bis 80 cm
Günstige Verhältnisse: Schwacher oder kein Wind.
Ungünstige Verhältnisse: Starker Wind, niedrige Temperaturen, glatte Gleitfläche auf Altschneedecken und Oberflächenreif auf der Schneedecke, Temperatur oder Beschaffenheit der Altschneeoberfläche. (Im Allgemeinen ungünstig: Altschneedecke mit Schwachschichten und Neuschnee darüber). Viel Schnee in kurzer Zeit, Beginn des Schneefalls und Übergang von Regen zu Schnee.
Bei sehr intensivem Schneefall kann in kurzer Zeit viel Schnee fallen. Das Gewicht des Schneefalls kann die Schneedecke stark belasten, und die tiefe, hartnäckige Schwachschicht kann brechen, was zu sehr großen Lawinen führen kann. Der Vorteil von Neuschnee ist, dass man Probleme relativ leicht erkennen und beheben kann.
Mögliche Gefahrenmuster
dp.1 Tiefe, anhaltende Schwachschicht / dp.4 Kalt auf warm / Warm auf kalt / dp.5 Schneefall nach längerer Kälteperiode
dp.8 Vergrabener Oberflächenreif / dp.9 Weiche Hagelkörner
WINDVERDREHUNG SCHNEE

Wind ist die Ursache für die häufigsten Lawinenabgänge (Schneebrettlawinen) in den Alpen der letzten Jahre. Während und unmittelbar nach Neuschneefall wird der lose, frische Schnee vom Wind von einem Gebiet in ein anderes transportiert und dort abgelagert. Dies bezeichnet man als Triebschnee.
Der von einem Gebiet transportierte Schnee wird als LUV bezeichnet, und dort, wo er zur Ruhe kommt, als LEE. Am häufigsten findet man den abgelagerten Schnee in steilen Rinnen, Mulden, hinter Graten und windstillen Gebieten auf der LEE-Seite. Dies geschieht typischerweise während oder unmittelbar nach leichtem bis starkem Schneefall.
Im Folgenden finden Sie einige wichtige Fragen, die Sie sich bei der Beurteilung einer solchen Situation nach Schneefall und stärkerem Wind stellen sollten, insbesondere beim Skifahren oberhalb der Baumgrenze in höheren Lagen.
Wie frisch ist der Triebschnee? Je frischer, desto gefährlicher.
Wie viel Triebschnee wurde abgelagert? Je mehr, desto gefährlicher.
Auf welcher Schneeoberfläche und -schicht wurde der Triebschnee abgelagert? Auf einer langen Kälteperiode, einer harten oder glatten, weichen Oberfläche oder auf einer Altschneedecke mit tiefen, hartnäckigen Schwachschichten. Oder auf einer kalten Oberfläche oder Oberflächenreif (Metamorphose), der in der Sonne glitzert, sich schlecht bindet und somit eine sehr ungünstige Situation darstellt?
Hängt auch von einer Hangneigung ab 30 Grad und der Hangexposition ab.
Prüfen Sie immer den Schneebericht des Tages!
Hinweise auf die Windrichtung und Triebschneegebiete im Lee können folgende sein:
Risse in der Oberfläche durch eigene Spuren beim Aufstieg, beim Abfahren oder beim Anfahren einer Abfahrt beim Freeriden.
Windgangeln: Der Wind schneidet den Schnee im Lee an der Oberfläche ab und lagert ihn im Lee ab. (Windgangeln stehen mit der Spitze gegen den Wind).
Schnee, der vor, während oder nach einem Schneefall über die Schneedecke weht.
Die Schneeoberfläche glänzt nicht, sondern ist eher matt/milchig-weiß, und der vom Wind verwehte Schnee ist kompakt und nicht locker an der Stelle, an der er abgelagert wurde.
Skifahren in vom Wind verwehtem Schnee: Sehr geringe Schneerückkopplung.
Auf Bergrücken und -gipfeln erkennt man „Windlippen“: Schnee, der von den Graten weht, und die Richtung des Schnees ist sehr deutlich (von und nach links).
Auf Schneedünen erkennt man einen wellenartigen Effekt und die Windrichtung.
Mögliche Gefahrenmuster
dp.1 Tiefe, anhaltende Schwachschicht / dp.4 Kalt auf warm / Warm auf kalt / dp.5 Schneefall nach langer Kälteperiode
dp.6 Lockerer Schnee und Wind / dp.8 Vergrabener Oberflächenreif
ANHALTENDE SCHWACHE SCHICHTEN (ALTE SCHNEEDECKE)

Die hier auftretenden Probleme sind die schwachen Schichten in der Schneedecke.
Man muss besonders vorsichtig sein, insbesondere wenn flache Schneedecken in tiefe Schneedecken übergehen und die schwächeren Schichten dort nahe der Oberfläche liegen, im Vergleich zu den tieferen Schichten. Dies ist an Geländerändern, an Graten und bei Schneemangel an den Rändern von Rinnen und Senken im Gelände zu beobachten.
Hier ist eine flachere Schneedecke weniger günstig, und die schwächeren Schichten liegen näher an der Oberfläche und sind anfälliger für Auslösungen durch zusätzliche Belastung. Umgekehrt ist es in tieferen Schneedecken, wo die schwächeren Schichten tiefer in der Schneedecke liegen, nicht so nahe an der Oberfläche und weniger anfällig für Auslösungen durch zusätzliche Belastung. In den Übergangszonen von flachen zu tiefen Schneedecken werden regelmäßig Lawinen ausgelöst.
Zu Beginn des Winters kommt es häufig nach dem zweiten großen Schneefall zu Schneebrettlawinen, meist in höheren Lagen (2000 bis 3000 m) an schattigen und steileren Hängen. Der Grund für diese Situation im Herbst liegt darin, dass nach dem Schneefall in der Regel eine längere Periode stabilen Hochdruckwetters und sehr geringer Niederschlagsmenge folgt. Zu dieser Zeit kann die Metamorphose des Schnees an der Basis des vorherigen Schneefalls stattfinden. Lockere Kristalle bilden sich, da der Boden wärmer ist und die Wärme in Richtung kälteren Schnees steigt. Hier findet die Metamorphose statt, wodurch die losen Kristalle eine schwächere Schicht in Bodennähe bilden. Diese tiefen, hartnäckigen Schwachschichten in Bodennähe werden meist zu Saisonbeginn von Skifahrern und Freeridern ausgelöst, sind aber auch in den schneearmen Wintermonaten möglich. Diese Situation kann auch im Frühjahr eintreten, da die schwächere untere Schicht ebenfalls durch mehr Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.
Die Stabilität der Schwachschichten in der Altschneedecke hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Die Tiefe der Schwachschicht
Wie viele Schwachschichten befinden sich in der Schneedecke?
Die Dicke der Schwachschicht
Die Festigkeit der Schneedecke (weich/hart/zersetzt)
Je dünner die Schwachschicht, desto anfälliger ist sie für Bremsungen durch zusätzliche Belastung. Dies ist sehr ungünstig, da die dünne Schicht dem von oben ausgeübten Druck nicht standhalten kann. Eine dickere Schwachschicht hingegen kann zusätzliche Belastungen aufnehmen und ist stabiler/günstiger, wenn Druck von oben ausgeübt wird, je nachdem, wie stark dieser über einen bestimmten Bereich der Schneedecke ausgeübt wird.
Je näher die Schwachschicht an der Oberfläche der Schneedecke liegt, desto wahrscheinlicher ist ein Bremsen durch zusätzliche Belastung. Je tiefer die Schwachschicht ist, desto besser ist sie durch die Schneedecke geschützt und wird nicht gestört, außer durch eine starke Belastung der Schneedecke. Eine große Gruppe von Skifahrern fährt gemeinsam mit zu geringem Abstand zueinander Ski.
Mögliche Gefahrenmuster
dp.1 Tiefe, anhaltende Schwachschicht / dp.4 Kalt auf warm / Warm auf kalt / dp.5 Schneefall nach längerer Kälteperiode
dp.7 Flache bis tiefe Schneedecken / dp.8 Vergrabener Oberflächenreif
NASSER SCHNEE

Regen, der auf und in die Schneedecke fällt, stellt ein hohes Lawinenrisiko dar. Der Grund dafür ist, dass das zusätzliche Gewicht die Schneedecke an diesem Hang gefährdet und die Bindung innerhalb der Schneedecke erheblich und sehr schnell verloren geht. Regen kann in den Wintermonaten jederzeit auftreten. Dies kann auch bei hohen Lufttemperaturen, intensiver Sonneneinstrahlung auf die Schneedecke, hoher Luftfeuchtigkeit und warmem Wind der Fall sein. All diese Faktoren können das Problem einer nassen Schneedecke verursachen, insbesondere bei geringer Schneedecke oder einem Winter mit geringer Schneedecke.
Nassschneelawinen, ob Schneebrett-, Lockerschnee- oder Gleitschneelawinen, können sehr plötzlich auftreten, schwerwiegende Folgen haben und die Behörden vor große Herausforderungen stellen.
Mögliche Gefahrenmuster
dp.3 Regen auf Schnee / dp.10 Frühlingssituation
GLEITENDER SCHNEE

Dabei gleitet die gesamte Schneedecke auf glatten Oberflächen, Grasbänken, glatten Felsflächen oder Eis.
Diese Lawinenarten entstehen, wenn die Verbindung zwischen der gesamten Schneedecke und dem Boden verloren geht, d. h., zwischen Schneedecke und Boden befindet sich eine Wasserschicht.
Gleitschneelawinen und -situationen sind schwer vorherzusagen, da sie direkt am Boden entstehen und sowohl bei trockener, kalter als auch bei nasser Schneedecke auftreten können.
Gleitschneelawinen treten typischerweise bei einer dicken Schneedecke mit wenigen oder keinen Schwachschichten auf. Gleitschneelawinen können sowohl bei trockener, kalter als auch bei nasser Schneedecke auftreten. Sie treten im Spätherbst bei großen Schneemengen in kurzer Zeit und im Frühjahr bei übermäßig feuchter Schneedecke auf.
Mögliche Gefahrenmuster
dp.2 Gleitschnee